Josef Ruhland | 06/2017 UPDATES: 01/2019; 10/2022; 03/2025)
Maria Bründl
Vom Rotbründl zum Glatzinger Bründl
Das ab Mitte des 18. Jh. für heilkräftig gehaltene Wasser des Glatzinger Bründls zog viele Leidende an - ursprünglich stand bei der Quelle nur ein Marienbildnis. Später wurde ein hölzerne Kapelle erbaut, 1840 stand beim Heilbründl schon eine aus Stein erbaute Kapelle.
Nachdem Josef II 1785 die Schließung der außerhalb des Kopfinger Friedhofes erbauten Filialkirche Maria Bründl (1753 - 1756, im Volksmund "Rotbründl" genannt) verfügt hatte, dürfte es zur Verlegung nach Glatzing gekommen sein. Die Marienstatue des nach der Schließung abgerissenen Kirchleins ist heute auf dem linken Seitenaltar der Pfarrkirche zu sehen.
Das Kirchlein mitsamt dem Patrozinium "Maria Heimsuchung" wurde beim Glatzinger Bründl neu errichtet, ungefähr dort, wo 1754 ja von Kopfing aus die wundersame Erscheinung des vierstrahligen Sterns zu beobachten gewesen sein soll.
Name wie Bedeutung des "Rotbründl" dürften nach dem Abriss der seit 1583 belegten Kopfinger Filialkirche zum Glatzinger Bründl "gewandert" sein, ebenso wie die Bezeichnung "Rotbründlinger" zu den dort lebenden Menschen.
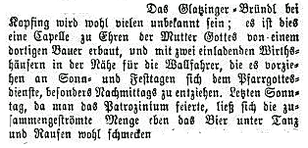
Schon 1832 (vgl. B. Pillwein, 4. Der Innkreis) wird ein Gesundheitsbrunnen "unweit von Kopfing auf der Weide Dirnseck" erwähnt - hier liegen vielleicht die Anfänge des Glatzinger Bründl ...
Interessant, dass Joseph II 1785 zwar die Kopfinger "Rotbründlkirche" - das eisenhaltige Wasser sorgte wohl für den Rost in der blechernen Rinne und damit für das "Rot" des Bründls - schließen ließ, aber nicht auch die Verlegung des um die Kirche angelegten Pfarrfriedhofs an den Ortsrand anordnete - wie es sonst oft geschah.
Der 2008 etwa 300 m östlich des Bründls entdeckte Brunnenschacht mit Quellstube und einer sehr kurzen Tonrohrleitung scheint in keiner direkten Verbindung zum Glatzinger Bründl zu stehen; Wissenschaftler vermuten eher die Anlage einer Viehtränke (Fritsch, in: Der Bundschuh 2011).
QUELLEN zur Geschichte der
Kopfinger Rotbründlkapelle und der Bründlkapelle in Glatzing
Johann Klaffenböck: Die Geschichte der Wallfahrten zur Rotbründlkapelle in Kopfing und zur Glatzinger Bründlkapelle (Bundschuh, XIV, 18)
Johann Klaffenböck: Vom Rotbründl zum Glatzinger Bründl (2022, Selbstverlag, Wambacher-Druck).
Johann Gschwendtner als Administrator der Kleindenkmalforschung in Kopfing:
https://www.ooegeschichte.at/forschung/kleindenkmal/111478

Links eine der ältesten Ansichten der Glatzinger Bründlkapelle;
diese war um 1820 als eine kleine hölzerne Kapelle erbaut worden. 1823 wurde das Innere neu ausgestaltet und auch das Türmchen erhielt ein neues Gesicht. 1840 wurde die hölzerne Kapelle durch einen Steinbau ersetzt .
Interessant auf dem linken Foto der Straßenverlauf: Der Weg führt zwischen Bründlwirtshaus und hölzerner Kegelbahn direkt zur Kapelle, wo auch die Abzweigung zum Weg (Kreuzweg) nach Matzelsdorf zu erkennen ist.
Der Bründlweiher ist im Franziszeischen Kataster (kartiert in unserer Region zwischen 1823 und 1830) noch nicht eingezeichnet. Etwa 50 m östlich, oberhalb des Weihers wurde 2008 ein alter Brunnenschacht mit einer kurzen Wasserleitung entdeckt; rund 250 m westlich befindet sich das Glatzinger Bründl.

Ansichtskarte (vor 1910):
Zu sehen das Ensemble Glatzinger Bründlkapelle und Bründlwirtshaus - was auch die Besitzverhältnisse wiedergibt.
1785 - im Jahr der Schließung der Kopfinger Rotbründlkapelle - kam Engertsberg mit den umliegenden Orten von der Pfarre Raab zur Pfarre Kopfing.

Glatzinger Bründl um 1920:
Das kleine Türmchen der Bründlkapelle blieb bis in die 1920er-Jahre - und viele Menschen kamen, um das heilkräftige Wasser zu trinken oder sich damit die Augen auszuwaschen,
Zum Dank wurden in der Kapelle Votiv- und Ölbilder, zerbrochene Krücken und Gehstöcke zurückgelassen: Das Glatzinger Bründl war zu einem Wallfahrtsort geworden.

Seit etwa 1930 besitzt die Bründlkapelle einen neuen, höheren Turm.
Das Kirchlein wurde dazu wegen des zunehmenden Andrangs durch einen apsisartigen Zubau vergrößert.

Nach dem 2. Weltkrieg gab es bis in die 1970er-Jahre viele Bittprozessionen, Wallfahrer kamen sogar aus Bayern.
Der alte Kreuzweg Richtung Matzelsdorf wurde im Jahr 2000 auf Initiative von Kons. Martin Strasser mit neuen Stationen versehen.

Bründl - Neubau (1978)
Unter Msgr. Alois Heinzl entstand der moderne Kapellenbau; wegen des nassen Quellgrundes wurde der Neubau gegenüber der alten Kapelle etwa 10 m vorverlegt.
Die Gnadenstatue (Bauernbarock, aus Eichenholz)
stand schon bei der alten Kapelle über dem heilkräftigen Bründl. Renoviert und hinter Glas steht sie heute am "alten Platz" beim Eingang zur Sakristei.

Das Innere der neuen Bründlkapelle wurde von Msgr. Alois Heinzl gestaltet:
Dominierend ein geschnitzter goldener Schrein, in dem die restaurierte Gnadenstatue der Mutter Gottes aus der Barockzeit zu sehen ist.
Die kleinen Figuren des Johannes Nepomuk und Petrus Kanisius sind Kopien vom alten Rotbründl-Altar in Kopfing (um 1750).
Unter den Votivbildern an der Chorbrüstung befindet sich über dem Eingang zum Beichtraum die wohl schönste Weihegabe (Kreuzpartikel, gefasst mit Stäbchen-Schnitzrahmen).
Das Bild der schmerzhaften Gottesmutter vor den Kreuzwegbildern (aus der alten Kapelle) an der rechten Seite dürfte wie mehrere Votivbilder von einem Votivmaler aus Enzenkirchen, einem Nachkommen der Schwanthaler, gemalt worden sein.
Die beiden Fenster (Glasmalerei, Stift Schlierbach) begrenzen die Altarwand mit dem Schrein mit der Mutter Gottes. Links und rechts davon befinden sich die Statuen des hl. Johannes Nepomuk und des hl. Pfarrers von Ars sowie zwei Engelköpfe. Über dem Schrein ist der Heilige Geist als Taube dargestellt.
Links und rechts der Altarwand befinden sich noch zwei spitzförmige Arbeiten vom alten Altar der Kapelle. Ebenfalls vom Vorgängerbau übernommen wurden das Absperrgitter und die „Ewige Lichtampel“.
Der Volksaltar besitzt einen 18 kg schweren Reliquienstein aus der alten Pfarrkirche (1891), die Kanzel, die Tabernakelsäule, der Priestersitz sowie die Ministrantenbänke sind zum Teil aus 300 – 500 Jahre altem Eichenholz des früheren Glockenstuhles (bis 1974 im Turm der Pfarrkirche) angefertigt.
Der alte Betschemel des Kopfinger Bildhauers Martin Plöckinger (+ 1974) wurde verbreitert, um für Brautpaare genügend Platz zu bieten. Nachdem die Zahl der Wallfahrten zurückging, sollte die neue Bründlkirche als eine Hochzeitskirche „belebt“ werden....
Quelle: Bericht Pfarrblatt (1978) und pers. Ergänzungen Dechant Heinzl

Die im Zeitungsbericht (oben) angeführten beiden Gasthäuser waren (nach dem alten Grundbuch) der "Bründlwirt" (Engertsberg 13) und das inzwischen abgerissene "Gasthaus zu Bründl", auch: "Uhrmacher" (Engertsberg 15).


